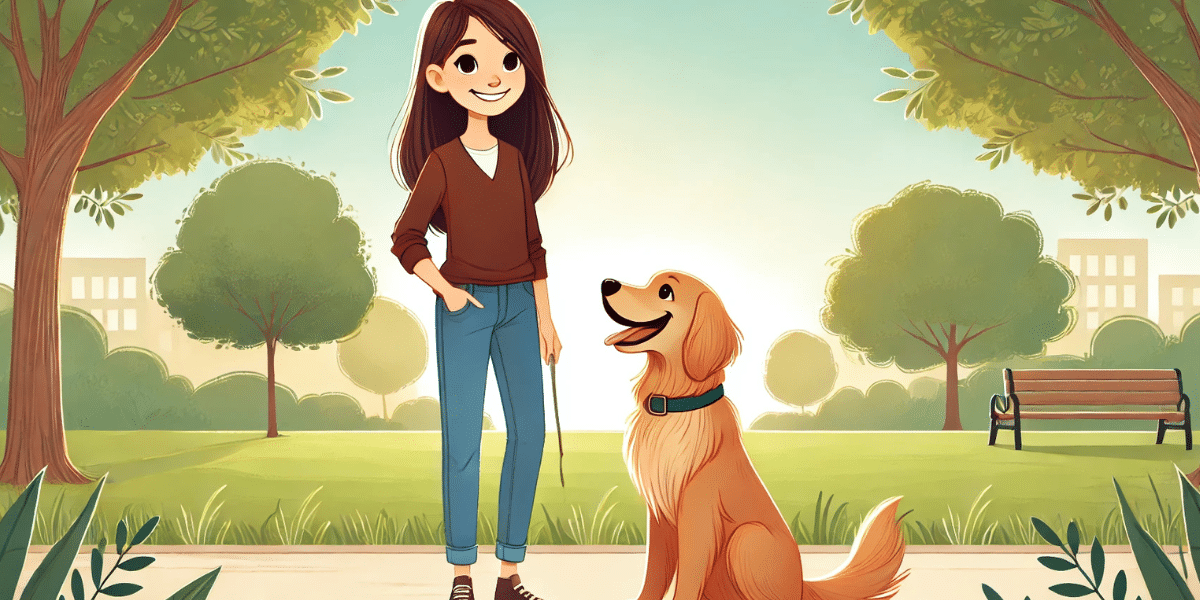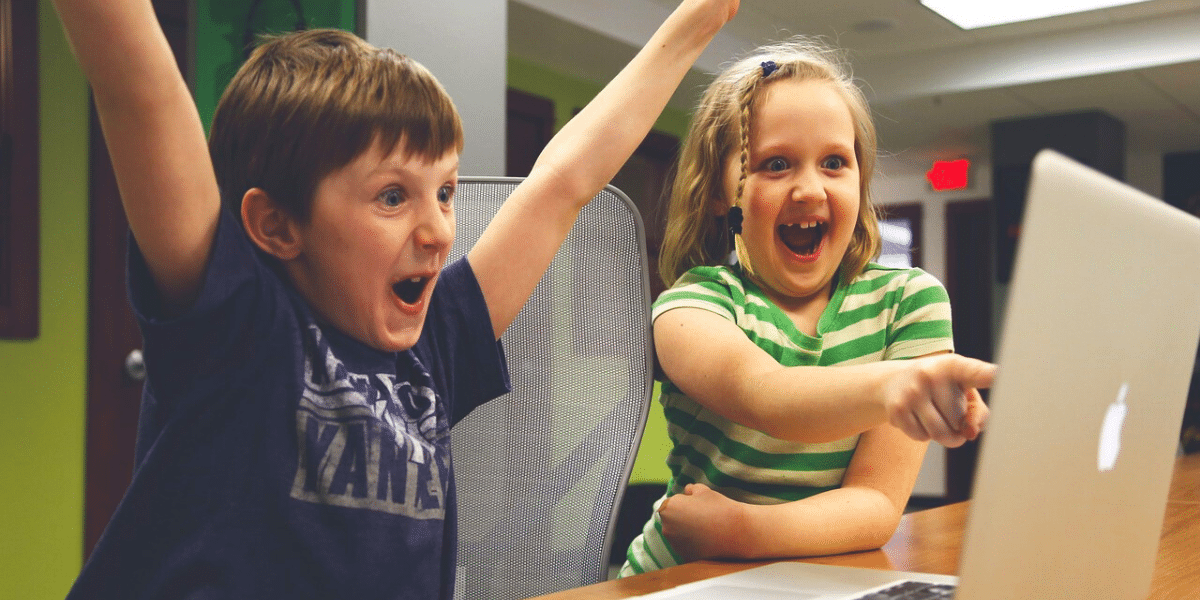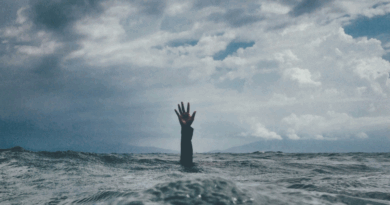Geschwisterrivalität fördern leicht gemacht – Welche Fehler Eltern besser nicht machen sollten.
Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Sie möchten, dass sie sich geliebt fühlen, dass sie einander schätzen, dass sie sich irgendwann gegenseitig in der Steuererklärung helfen oder sich beim Umzug die Möbel schleppen. Aber bis dahin? Bis dahin neigen viele Eltern leider dazu, ihre Kinder unbewusst in einen Konkurrenzkampf zu schicken.
„Schau mal, wie ordentlich deine Schwester ist!“, „Warum kannst du nicht so fleißig sein wie dein Bruder?“, „Deine Schwester hilft mir immer so toll!“ – solche Sätze scheinen harmlos, aber sie haben eine Nebenwirkung, die kaum jemand sofort bemerkt: Sie verwandeln Geschwister in Rivalen.
Warum Eltern oft unbewusst vergleichen – und wie man es vermeidet
Vergleiche passieren oft aus den besten Absichten. Eltern wollen motivieren, anspornen, eine kleine Flamme entzünden. Doch was beim ersten Kind noch als „motivierende Ansprache“ gedacht war, fühlt sich beim zweiten Kind an wie eine versteckte Kritik.
Warum? Weil ein Vergleich immer automatisch mit einer Wertung einhergeht. Ein Kind wird gelobt, das andere… naja, eben nicht. Und Kinder nehmen das nicht sportlich („Oh, danke für das wertvolle Feedback, Mama, ich werde daran arbeiten!“), sondern persönlich („Aha, also bin ich nicht gut genug.“).
Besser wäre: Jedes Kind für sich loben. Anstatt zu sagen „Deine Schwester hilft mir immer so toll!“, lieber „Ich finde es toll, wie du mir geholfen hast!“ Damit wird das eine Kind nicht zum Maßstab für das andere.
Der Lieblingskind-Effekt: Wie Kinder unbewusst Rollen zugewiesen bekommen
Ob Eltern es wollen oder nicht – fast jedes Kind hat irgendwann das Gefühl, dass es ein „Lieblingskind“ gibt. Vielleicht ist es das erste Kind, weil es die Eltern durch all ihre „Erstlingsfehler“ begleitet hat. Vielleicht das Jüngste, weil es als „Nesthäkchen“ betüdelt wird.
Kinder spüren das. Und sie beginnen, ihre Rolle anzunehmen. Das „Vernünftige“, das „Wilde“, das „Talentierte“ oder das „Schwierige“ – einmal in so eine Schublade gesteckt, wird es verdammt schwer, wieder herauszukommen.
Die Lösung? Die Rollen immer wieder durchbrechen. Wenn das „Stille“ Kind plötzlich wild tanzt, nicht sagen: „Oh wow, das hätte ich von dir gar nicht erwartet!“, sondern einfach: „Ich liebe es, dich so zu sehen!“ Wenn das „Wilde“ mal ruhig malt, nicht kommentieren: „Huch, du kannst ja auch mal still sein!“, sondern: „Das ist ein tolles Bild!“
Die Rolle der Geburtsreihenfolge – Warum sich Erstgeborene oft benachteiligt fühlen und Jüngere rebellieren
Erstgeborene haben es nicht leicht. Sie müssen den Weg bereiten, die Erziehungsexperimente der Eltern über sich ergehen lassen und „vernünftig“ sein, weil die Eltern irgendwann keine Lust mehr auf Chaos haben. Jüngere Geschwister? Die dürfen alles ein bisschen lockerer nehmen, weil Mama und Papa beim zweiten Kind verstanden haben, dass Kinder auch mit drei Jahren noch überleben, wenn sie Sand essen.
Kein Wunder, dass Erstgeborene oft überkorrekt und ehrgeizig werden – oder sich irgendwann lautstark beschweren, dass der kleine Bruder mit sechs noch mit dem Löffel gefüttert wird, während sie mit vier schon ihr Frühstück selbst schmieren mussten.
Und die Jüngeren? Die kämpfen oft gegen das „Ach, du bist doch der Kleine“-Image und entwickeln sich entweder zur lauten Rampensau oder zur Rebellin der Familie.
Eltern-Tipp: Bewusst ausgleichen! Das ältere Kind nicht automatisch als „Vernünftiges“ abstempeln und das Jüngere nicht ständig unterschätzen. Und vor allem: Regeln und Erwartungen für alle fair halten – auch wenn das Jüngste noch so süß guckt.
Geschwisterstreit: Wie viel ist normal – und wann sollten Eltern eingreifen?
Eltern träumen davon, dass ihre Kinder sich ein Leben lang lieben und unterstützen. Kinder haben andere Prioritäten. Vor allem, wenn es darum geht, wer auf dem Vordersitz sitzen darf oder wem der größere Schokoladenkeks zusteht.
Streit gehört dazu. Es hilft Kindern, zu lernen, wie man mit Konflikten umgeht. Was aber nicht dazugehört: Ständige Vergleiche oder eine Atmosphäre, in der einer immer als „Schuldiger“ dasteht.
Eltern sollten Schiedsrichter sein, aber keine Richter. Das bedeutet: Grenzen setzen, aber den Kindern Raum geben, ihre Konflikte selbst zu lösen. Denn wenn Eltern immer einen „Gewinner“ und einen „Verlierer“ bestimmen, festigt sich nur das Gefühl von Ungerechtigkeit.
Wenn der Geschwistervergleich bis ins Erwachsenenalter nachhallt
Kinder, die ständig miteinander verglichen wurden, tragen diesen Kampf oft unbewusst weiter. Der eine hat immer das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Die andere fühlt sich immer noch als „die Vernünftige“, selbst wenn sie längst nicht mehr die ältere Schwester ist, die alles regeln muss.
Das zeigt sich oft in Karrieren, in Beziehungen – oder wenn man mit 35 plötzlich merkt, dass man sich immer noch unwohl fühlt, wenn die Eltern von den Erfolgen des Geschwisterchens erzählen.
Der Punkt ist: Vergleiche verschwinden nicht mit der Kindheit. Sie bleiben oft ein Leben lang bestehen. Es lohnt sich also, von Anfang an darauf zu achten, dass Geschwister sich nicht als Konkurrenten, sondern als Team wahrnehmen.
Wie Eltern Geschwister als Team stärken können
Anstatt Rivalität zu fördern, können Eltern bewusst die Geschwisterbindung stärken. Wie?
- Gemeinsame Erlebnisse schaffen: Ausflüge, Spieleabende, besondere Rituale.
- Verantwortung teilen: „Könnt ihr zusammen das Abendessen vorbereiten?“ statt „Wer hilft mir heute – du oder deine Schwester?“
- Erfolge gemeinsam feiern: Anstatt nur ein Kind zu loben, die Freude teilen: „Ich bin so stolz auf euch beide!“
- Kein Favoritenspiel: Ja, ein Kind ist vielleicht ordentlicher, das andere kreativer – und? Das eine ist nicht mehr wert als das andere.
Liebe ist kein Wettbewerb
Geschwister können das größte Geschenk des Lebens sein – wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie sich Liebe und Anerkennung erkämpfen müssen. Eltern können viel für den Familienfrieden tun, wenn sie ihre Kinder als individuelle Persönlichkeiten wahrnehmen und sie nicht gegeneinander ausspielen.
Denn was wir unseren Kindern heute mitgeben, prägt ihre Beziehung zueinander ein Leben lang. Und wäre es nicht schön, wenn sie als Erwachsene nicht nur Geschwister, sondern auch echte Freunde sind?