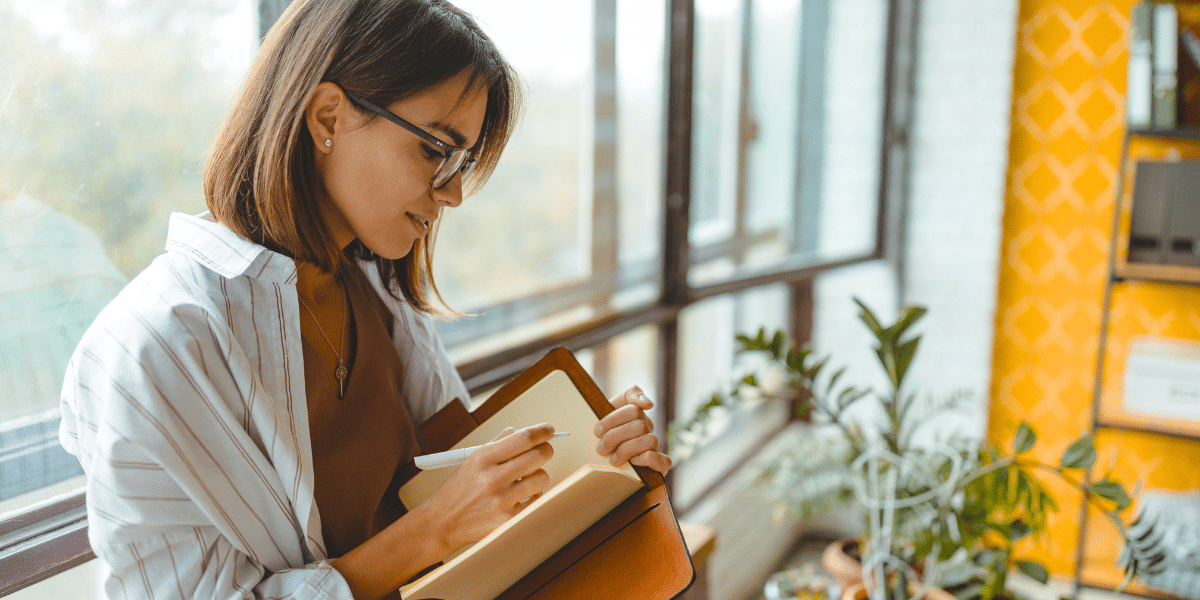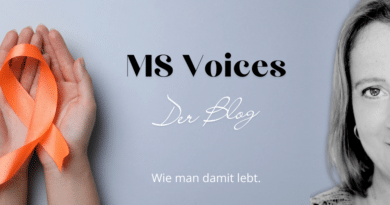Die Kunst, traurig zu sein – auf unterschiedliche Weise
Eine Betrachtung über Depression, Geschlechter und das Übersehen von Schmerz
Es gibt diese Tage, an denen man aufwacht und denkt: Wozu eigentlich? Nicht im dramatischen Sinne, nicht mit konkreten Selbstmordgedanken – einfach nur: Wozu? Warum aufstehen? Warum duschen? Warum so tun, als ob alles in Ordnung wäre?
Jeder kennt solche Tage. Aber wenn aus solchen Tagen Wochen werden, und aus Wochen Monate – dann ist das keine schlechte Laune mehr. Dann ist das eine Depression.
Und auch hier – auch hier wieder dieses absurde Phänomen: Depression sieht bei Frauen völlig anders aus als bei Männern. Aber wir behandeln sie, als wäre das egal.
Lass mich dir von zwei Menschen erzählen.
Beide depressiv. Beide leiden. Aber wenn du sie nebeneinander stellen würdest, würdest du nicht glauben, dass sie dieselbe Krankheit haben.
Da ist Thomas. Mitte vierzig, Familienvater, Ingenieur. Thomas ist in letzter Zeit unglaublich gereizt. Er rastet wegen Kleinigkeiten aus – die Kinder sind zu laut, das Essen schmeckt nicht, der Verkehr ist unerträglich. Er stürzt sich in die Arbeit, arbeitet bis spät nachts, am Wochenende geht er exzessiv joggen. Zehn, fünfzehn Kilometer. Er trinkt abends mehr Bier als früher. Zwei, drei, vier Flaschen. Er fährt zu schnell Auto. Er geht Risiken ein.
Wenn du ihn fragst, wie es ihm geht, sagt er: “Alles gut. Nur viel Stress.”
Depression? Niemals würde er auf diese Idee kommen. Depression ist doch was für Weicheier. Depression heißt doch, dass man im Bett liegt und heult. Das macht Thomas nicht. Also hat er auch keine Depression.
Falsch.
Dann ist da Susanne. Anfang fünfzig, Lehrerin, Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Susanne zieht sich zurück. Sie sagt Verabredungen ab. Sie liegt abends auf dem Sofa und starrt an die Decke. Sie grübelt. Stundenlang. Über alles. Über nichts. Sie macht sich Vorwürfe. Warum ist sie keine bessere Mutter gewesen? Warum hat sie im Job nicht mehr erreicht? Warum ist sie überhaupt so, wie sie ist?
Sie weint oft. Grundlos, wie es scheint.
Sie fühlt sich leer. Ausgehöhlt. Als wäre sie nur noch eine Hülle, in der nichts mehr ist. Sie entschuldigt sich ständig. Bei ihrem Mann, bei den Kindern, bei Kolleginnen. “Es tut mir leid, dass ich so bin. Es tut mir leid, dass ich euch zur Last falle.”
Wenn du sie fragst, wie es ihr geht, sagt sie: “Ach, es geht schon. Ich muss mich nur zusammenreißen.”
Depression? Natürlich. Aber auch Susanne würde lange brauchen, um das zu akzeptieren. Denn sie denkt: Depression ist eine richtige Krankheit. Ich bilde mir das doch nur ein.
Auch falsch.
Verstehst du, was ich meine? Zwei Menschen, eine Krankheit – aber die Art, wie sie sich zeigt, ist so unterschiedlich, dass man meinen könnte, es handle sich um völlig verschiedene Leiden.
Der depressive Mann versteckt seine Depression hinter Aggression, Rastlosigkeit, Risikoverhalten. Er funktioniert weiter – oder tut zumindest so. Er rennt vor seinem Schmerz davon, betäubt ihn mit Arbeit, Sport, Alkohol. Depression im Tarnanzug.
Die depressive Frau fühlt sich schuldig
Die depressive Frau dagegen zieht sich zurück, wird still, grübelt endlos. Sie fühlt sich schuldig – für alles! Sie weint. Sie entschuldigt sich. Sie macht sich klein. Und weil das so sehr dem entspricht, was die Gesellschaft von Frauen ohnehin erwartet – nett sein, sich zurücknehmen, emotional sein –, fällt es oft erst spät auf. Oder wird als “typisch Frau” abgetan.
Das ist doch grotesk, oder?
Jahrzehntelang hat die Psychiatrie Depression hauptsächlich so definiert, wie sie bei Männern aussieht. Antriebslosigkeit, Interessenverlust, gedrückte Stimmung – ja, das trifft zu. Aber eben nur zum Teil. Die weibliche Depression mit ihrer Schuldkomponente, ihrer Grübelei, ihrer nach innen gerichteten Aggression – die kam lange zu kurz.
Und dann wundern wir uns, warum so viele Frauen jahrelang unbehandelt bleiben. Warum sie denken, sie müssen sich “nur zusammenreißen”. Warum sie sich schämen, Hilfe zu suchen.
Weißt du, was mich dabei am meisten ärgert? Dass beide – Thomas und Susanne – leiden. Beide brauchen Hilfe. Beide haben eine Krankheit, die behandelbar ist. Aber beide glauben, sie seien einfach nur schwach. Oder überarbeitet. Oder charakterlich mangelhaft.
Dabei ist Depression nichts, wofür man sich schämen müsste. Es ist keine Charakterschwäche. Es ist keine Einbildung. Es ist eine Krankheit. Und wie bei jeder Krankheit gibt es Behandlungsmöglichkeiten.
Aber dafür muss man sie erst mal erkennen. Bei sich selbst. Und bei anderen.
Also, wenn du das nächste Mal jemanden siehst – eine Freundin, einen Bruder, einen Kollegen –, der sich verändert hat. Der gereizter ist als sonst. Oder stiller. Der sich zurückzieht. Oder sich in die Arbeit stürzt. Der weint. Oder übermäßig viel trinkt. Dann frag nach. Nicht einmal. Immer wieder.
Und wenn du selbst merkst, dass irgendetwas nicht stimmt – dass die Freude fehlt, dass alles zu viel ist, dass du nur noch funktionierst oder gar nicht mehr funktionierst –, dann hol dir Hilfe. Beim Hausarzt, beim Therapeuten, bei einer Beratungsstelle.
Depression ist behandelbar. Aber nur, wenn man sie sieht.
Thomas übrigens ist inzwischen in Therapie. Es hat gedauert, bis seine Frau ihn überredet hat. Aber es geht ihm besser. Und Susanne auch. Sie nimmt Antidepressiva und geht zur Gesprächstherapie. Sie sagt, es fühlt sich an, als käme langsam wieder Farbe in die Welt.
So soll es sein.
Pass auf dich auf. Und auf die anderen.
Deine Ute
Quelle: Das Bundesministerium für Forschung stärkt seit 2017 die geschlechtersensible Forschung in Deutschland und fördert Studien zu geschlechtsbedingten Unterschieden bei Versorgung und Prävention Wichtige Erkenntnisse: Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen anders als bei Männern, ebenso unterscheiden sich die Symptome einer Depression.