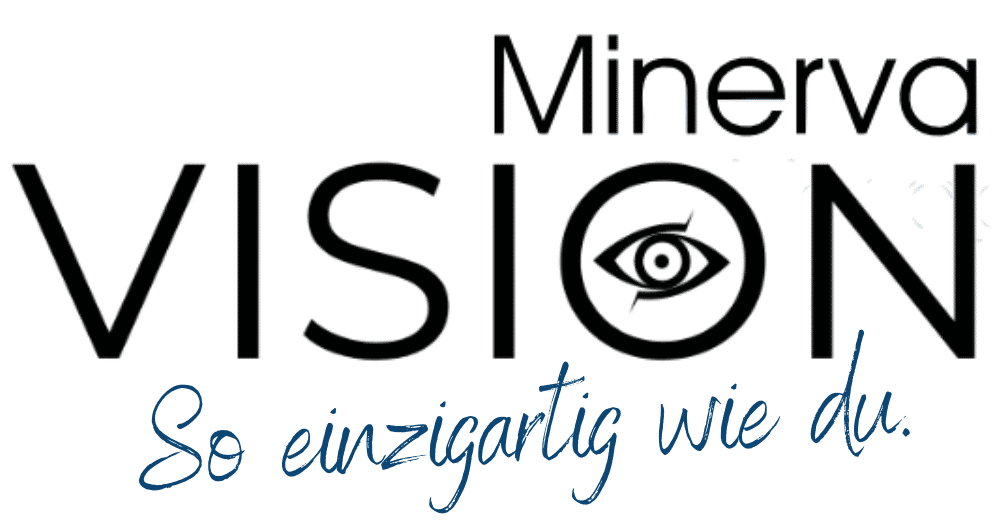Narzisstische Mutter: Spieglein, Spieglein, an der Wand – wer ist die Schönste im ganzen Land?
Wenn du mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen bist, kennst du diesen Blick vielleicht: prüfend, bewertend, fordernd – und nie wirklich liebevoll.
Als Kind spürt man früh, dass Liebe nicht einfach da ist, sondern verdient werden muss. Man lernt, sich anzupassen, Erwartungen zu erfüllen, stark zu sein. Und irgendwann fragt man sich: Wer bin ich eigentlich – jenseits all der Rollen, die ich für sie gespielt habe? Dieser Text ist für alle, die aufgewachsen sind, ohne wirklich gesehen zu werden. Und die jetzt anfangen, sich selbst zu entdecken.
Als Julia das erste Mal in meine Praxis kam, wirkte sie wie jemand, der alles im Griff hat: gepflegt, freundlich, zugewandt. Gut gekleidet, die Haare lagen schön – jedes an seinem Platz. In ihrer Gegenwart dachte ich unwillkürlich immer daran, dass ich selbst dringend nochmal zum Friseur sollte. Sie lächelte oft, eigentlich immer. Sogar wenn sie von wirklich belastenden Dingen sprach. Alles war eigentlich gar nicht so schlimm, und eigentlich wüsste sie auch nicht so genau, warum sie da wäre. Erst als ich sie fragte: „Wie geht es Ihnen – wirklich?“, begann ihr Blick zu flackern. Dann sah sie mich an, das erste Mal wirklich offen und ohne dieses Lächeln. „Ich weiß es nicht“, sagte sie und zuckte hilflos mit den Schultern. „Ich funktioniere. Ich bin Mutter, Ehefrau, Kollegin, Tochter. Aber manchmal weiß ich gar nicht, ob da unter all dem noch jemand ist. Und was ich will, weiß ich auch nicht. Ich bin wie ein Roboter – ich laufe, laufe und laufe und fühle rein gar nichts mehr. Verstehen Sie mich, es geht mir nicht wirklich schlecht. Aber es geht mir eben auch nicht gut. Ich bin irgendwie….. unbestimmt“. Mittlerweile rang sie mit den Händen. Dafür, dass es ihr angeblich gar nicht so schlecht ging, war dies schon eine sehr ausdrucksstarke Geste.
Was Julia beschrieb, begegnet mir oft in meiner Arbeit. Menschen wie sie – klug, feinfühlig, pflichtbewusst – suchen mich auf, wenn etwas in ihnen leise zusammenbricht. Das ist kein lauter oder dramatischer Zusammenbruch, sondern ein Prozess, der kaum wahrnehmbar ist. Wie ein Kartenhaus, das lange gestanden hat, weil man immer wieder vorsichtig drumherum gegangen ist. Ein Luftzug reicht, die erste Karte sinkt zusammen und dann sackt der ganze Rest ein.
In unserer dritten Sitzung sagte Julia dann einen Satz, der mich nicht mehr losließ:
„Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang das gelebt, was andere wollen – aber ich war nie ich selbst. Ich weiß gar nicht, wie das geht.“
Und da war er: der rote Faden.
Die Geschichte hinter der Geschichte.
Der Anfang vom Aschenkind.
Ein Spiegel zeigt dir, wie du aussiehst – aber nicht, wer du bist.
Diese Geschichte beginnt wie so viele – am Anfang. Und zwar in der Zeit, in der wir Kinder waren. Wir kommen auf die Welt, vollkommen frei. Und ohne Etikett. Keiner von uns kommt auf die Welt und denkt sich: „Mein Gott, was bin ich klug.“ Oder „Mist, warum bin ich nur so schwierig!“. Wir sind einfach. Und dann gewinnen wir Erkenntnis über das, was wir sind. Und zwar durch die ersten Menschen um uns herum, die uns spiegeln, indem sie auf uns reagieren. Auf unsere Freude, unsere Traurigkeit, unsere Wut. Wir bekommen unsere ersten Etiketten – und die graben sich tief ein. Man nennt diesen Prozess „Spiegelung“.
Echte Spiegelung bedeutet:
Die Mutter nimmt wahr, was im Kind geschieht, benennt es in einer emotional angemessenen Weise – ohne es zu bewerten oder zu manipulieren. Wir reden also hier vom Idealzustand. Damit man es besser versteht, nenne ich einfach mal ein Beispiel:
Das Kind fällt hin und erschrickt. Die Mutter sagt: „Oh, das hat dich gerade sehr erschreckt, stimmt’s?“ Damit sagt sie nicht: Stell dich nicht so an! oder Oh Gott, das war schlimm! – Sie spiegelt nur das Gefühl, nicht ihre eigene Angst oder Genervtheit, also ihre eigene Interpretation. Und das Kind? Lernt, ahaaaa – so fühlt sich also Schreck an. Und dann kann es in Zukunft seine Reaktion auf neutrale Weise und ohne Scham oder Hemmung benennen. Immer, wenn es etwas Ähnliches fühlt, sagt es: „Ich habe mich erschreckt!“. Das Kind lernt aber nochviel mehr. Es lernt: Das, was ich fühle, ist real und ich bin nicht allein damit. Meine Mutter fühlt das gleiche. Wie schön ist es doch, dass ich verstanden werde. Diese Erfahrung ist kein abstrakter Gedanke, sondern eine körperlich-emotionale Verankerung: das Kind fühlt sich so „gehalten“, „angebunden“ oder „verbunden“. So entwickelt ein Kind seine persönliche Integrität. Gehen wir zurück zu dem Beispiel: Das Kind weiß nun, wie es ist, sich zu erschrecken. Das ist der Ursprung von Selbstwahrnehmung, von Identität, vom Ich.
Wenn Spiegel fehlen oder verzerrt sind
Wenn wir lachen und jemand mitlacht – fühlen wir uns angenommen. Wenn wir traurig sind und jemand uns tröstet, erleben wir, dass diese Gefühle erlaubt sind. Fehlen solche Spiegel oder sind sie verzerrt (z. B. durch Missachtung, Ignoranz oder gar narzisstische Eltern), dann verlieren wir den Zugang zu unserem wahren Selbst. Stattdessen entwickeln wir ein falsches Selbst – das, was andere sehen wollen. Eltern sind deshalb so etwas wie Begleiter. Sie geben dem Kind die Bezeichnung für Gefühle und helfen ihm so zu entdecken, was in ihm steckt. Das ist der Ursprung – oder das innere Kind, wie es heute gerne genannt wird. Entscheidend ist, dass wir alle nicht als leeres Gefäß auf die Welt gekommen, sondern dass in uns schon etwas schlummert. Je früher wir das erkennen, uns erkennen, je glücklicher und erfüllter verläuft unser Leben. Was geschieht aber nun, wenn ein Kind diese Spiegelung nicht bekommt, sondern wenn ihm nur gespiegelt wird, was jemand anderes sehen will? Wenn also sofort eine Bewertung kommt wie: „Das ist nicht schlimm, stell dich nicht so an!“ Dann lernt es nicht sich selbst kennen – sondern es lernt, sich zu verleugnen. Sich anzupassen. Es wird geformt und nicht begleitet. Und damit wird es anders, als es ursprünglich gedacht ist. Im extremsten Fall wird es zum Spiegel der Mutter und damit entfremdet es sich von seinem Inneren.
Und genau das ist der Unterschied zwischen einer narzisstischen Mutter und einer entwicklungsfördernden Mutter:
- Die narzisstische Mutter sieht sich selbst im Kind
- Die zugewandte Mutter sieht das Kind im Kind
Ein sehr schönes Beispiel, wohin das führt, finden wir im Märchen Schneewittchen. Dort spielt der Spiegel der bösen Königin eine zentrale Rolle. Er ist kein gewöhnlicher Spiegel, sondern ein magischer Spiegel, der die Wahrheit sagt – aber nur in Bezug auf äußere Schönheit. Die Königin fragt:
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“
Und solange der Spiegel ihr antwortet, dass sie die Schönste sei, ist alles gut. Doch als er einmal sagt, Schneewittchen sei viel schöner als sie, zerbricht ihre Welt. Denn was der Spiegel sagt, bestimmt ihren Selbstwert. Nicht das, was sie fühlt. Ich vermute, ihre Mutter war narzisstisch. Und die Folge ist dramatisch. Die Königin ist abhängig vom äußeren Spiegel, weil sie keinen inneren hat. Die Folgen sind im Märchen auch beschrieben. Sie schafft es nicht, nach Innen zu schauen und sucht ihr Leben lang im Außen nach Bestätigung. Sie definiert sich durch Vergleiche, Konkurrenz, Rivalität. Und so wird man entweder zum Opfer oder zum Täter – aber nicht zum ICH. Man lässt sein Selbst von anderen definieren, weil die stabile Selbstwahrnehmung fehlt.
Was ist ein Spiegelkind?
Ich nenne Menschen wie Julia Spiegelkinder.
Spiegelkinder sind Kinder, die nicht als das gesehen wurden, was sie waren – sondern als das, was jemand anderes in ihnen sehen wollte.
- Die brave Tochter, die immer „so leicht“ war
- Der stille Junge, der nie zur Last fiel
- Die Perfektionistin, die alles richtig macht
- Die Helferin, die sich um alle anderen kümmert, aber sich selbst vergisst
Diese Kinder wurden nicht erkannt als das, was sie waren, sondern als das benutzt, was andere in ihnen sehen wollten. Sie wurden nicht gefragt:
Wer bist du? Was fühlst du? Was brauchst du gerade?
Sondern sie wurden – meist ganz unbewusst – verformt in ein Bild, das die Erwachsenen aus ihnen machten.
Kinder brauchen Erwachsene, die sich für sie interessieren – nicht für eine Vorstellung davon, wie sie sein sollen, denn Kinder sind keine ungeformten Rohlinge, kein Beweis für elterliche Leistung. Sie sind von Natur aus ein individuelles Ich, das begleitet und entdeckt werden möchte – nicht modelliert. Wenn Kinder nicht als die erkannt werden, die sie sind, sondern als Wunschbild, als Störung, als Projektionsfläche, passiert etwas sehr Trauriges: Das Kind lernt, sich selbst zu verlassen – um die Liebe der anderen nicht zu verlieren.
Es zieht sich von innen zurück. Nicht sofort. Aber Stück für Stück. Und irgendwann sagt es Sätze wie:„Ich weiß nicht, wer ich bin.“. Oder: „Ich weiß nicht, was ich will – nur, was andere brauchen.“
Die Kindheit im falschen Spiegel
Ein gesundes Familiensystem fragt nicht: Was soll aus dir werden? Sondern: Was ist schon da – und will wachsen?
Das Kind ist dann kein Spiegel – sondern ein Fenster. Ein Fenster in eine neue Welt, die noch niemand gesehen hat. Und die niemand formen muss – sondern erkennen darf.Ein narzisstisch geprägtes System dagegen tut genau das Gegenteil. Es gibt dem Kind das Gefühl, es müsse etwas leisten, um geliebt zu werden. Es müsse jemand werden, um wertvoll zu sein.
In solchen Familien wird das Kind zum Spiegel. Nicht zur eigenständigen Person, sondern zur Projektionsfläche.
Die Mutter fragt nicht: Wer bist du?
Sondern: Was spiegelst du mir – über mich?
Und das hat Folgen, die ein Leben lang anhalten
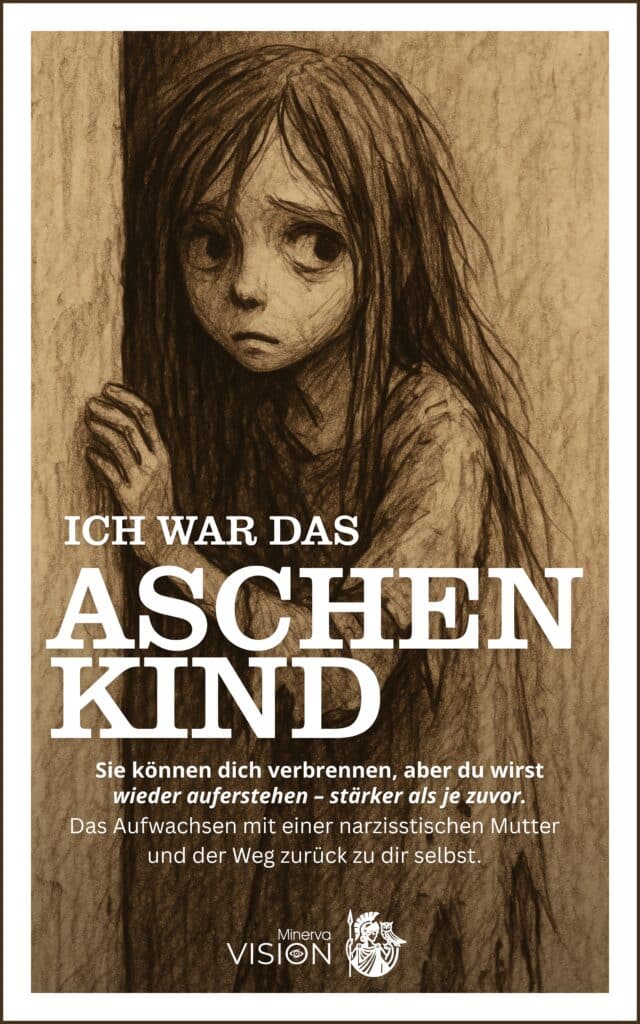
Zum Weiterlesen: “Aschenkind” von Livia Brand. Viele Kinder narzisstischer Mütter wachsen äußerlich „gut“ auf. Sie sind gepflegt. Werden pünktlich zur Schule gebracht. Haben eine Brotdose mit geschnittenem Obst. Was fehlt, ist nicht das Sichtbare – es fehlt das Gesehenwerden. Betroffene wissen im Inneren, dass etwas nicht stimmt, haben aber keine Worte dafür. Ein Selbsthilfe-Ratgeber für alle, die glauben, nicht richtig zu sein. Es kann sein, dass die Ursache gar nicht in dir liegt.