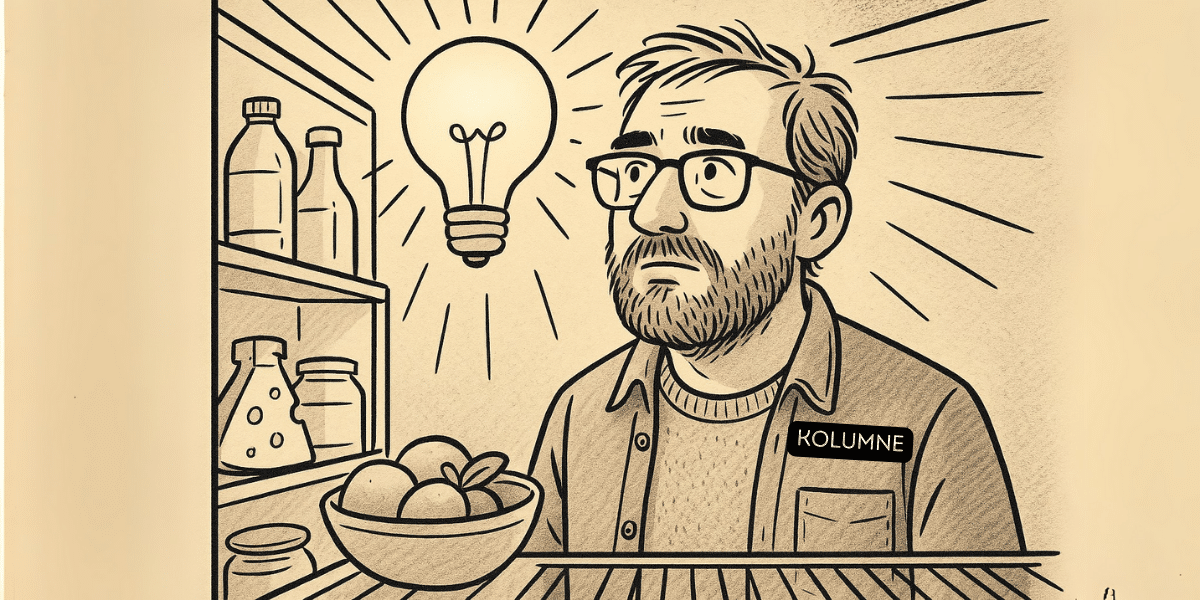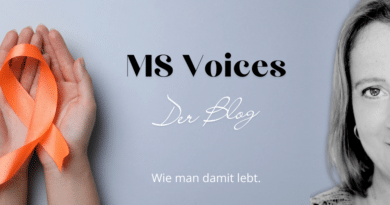Immuntherapie: Wenn die Krebsbehandlung plötzlich zum Diabetes führt
Moderne Immuntherapien sind kleine medizinische Wunder: Sie können Krebszellen gezielt bekämpfen und vielen Menschen das Leben retten oder deutlich verlängern. Aber manchmal nimmt das starke Immunsystem auch die falschen Zellen ins Visier. Bei einer bestimmten Behandlung, den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, kann es dazu kommen, dass unser Körper die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse angreift. Die Folge? Ein ganz neuer, plötzlich auftretender Diabetes.
Was steckt dahinter?
Mediziner nennen diese Form Checkpoint-Inhibitor-assoziierten Diabetes mellitus (CIADM). Klingt kompliziert, bedeutet aber: Der Körper produziert plötzlich gar kein Insulin mehr. Ein Schock, gerade für Menschen, die vorher nie mit Diabetes zu tun hatten. Und das kann richtig gefährlich werden: Viele entwickeln eine Ketoazidose, eine bedrohliche Übersäuerung des Blutes. Symptome können starker Durst, häufiges Wasserlassen, unerklärlicher Gewichtsverlust oder Müdigkeit sein.
Ein Balanceakt fürs Immunsystem
Checkpoint-Inhibitoren sind so etwas wie Trainer für unsere körpereigene Abwehr. Sie helfen ihr, die Krebszellen zu erkennen und anzugreifen. Das Problem: Manchmal schießt das Immunsystem übers Ziel hinaus und attackiert auch gesunde Zellen — so zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse.
Zusätzlich können auch andere hormonproduzierende Organe betroffen sein, etwa die Schilddrüse oder die Nebennieren.
Warum wir spezialisierte Teams brauchen
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) fordern jetzt, dass alle Krebszentren eigene Teams aus Diabetes- und Hormonspezialist:innen bekommen. Gerade bei älteren Patient:innen oder Menschen mit mehreren Vorerkrankungen ist es wichtig, dass man nicht nur den Krebs, sondern auch den gesamten Hormonhaushalt im Blick hat.
Was wir selbst tun können
- Offen mit dem Arzt sprechen: Unbedingt fragen, ob bei der eigenen Krebstherapie solche Nebenwirkungen vorkommen können.
- Körperwarnzeichen ernst nehmen: Bei starkem Durst, viel Wasserlassen oder plötzlichem Schwächegefühl lieber einmal zu viel zum Arzt gehen.
- Regelmäßig Blutzucker kontrollieren: Auch wenn man bisher kein Diabetes hatte.
- Sich Unterstützung holen: Schulungen und engmaschige Betreuung können im Ernstfall Leben retten.
Gemeinsam stark
Wir wissen: Eine Krebsdiagnose ist schon Belastung genug. Da braucht niemand noch die Sorge um plötzlichen Diabetes obendrauf. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, sich zu informieren, auf den eigenen Körper zu hören und sich früh Hilfe zu holen. Denn am Ende wollen wir doch alle das Gleiche: leben, lachen, lieben — und das so lange und so gesund wie möglich.
Also: Gut auf uns achten, Fragen stellen und bei Zweifeln lieber einmal mehr den Blutzucker checken. Wir schaffen das, zusammen!
Der Kommentar von Jonas, unserem Experten für Neurobiologie:
Ja, unser Körper ist ein echtes Wunderwerk — bis er plötzlich anfängt, gegen uns zu arbeiten. Dann denkt man sich: „Was soll das denn jetzt? Ich wollte doch nur gesund werden, nicht gleich noch Diabetes gratis dazu!“
Genau das passiert manchmal bei diesen modernen Immuntherapien. Die sind wie ein Wachrüttel-Trainer fürs Immunsystem: „Los, wach auf! Kämpf gegen den Krebs!“ Aber manchmal hat das Immunsystem so viel Schwung, dass es gleich noch andere Baustellen anfängt, inklusive Angriff auf die eigenen Insulinzellen.
Das Ergebnis? Ein völlig neuer Typ Diabetes, der vorher nicht da war. Für die Betroffenen ist das natürlich ein Schock. Gerade weil man denkt: „Ich hab doch genug mit dem Krebs zu kämpfen, muss ich jetzt auch noch Insulin spritzen lernen?“
Aber hier kommt die gute Nachricht: Wer Bescheid weiß, ist klar im Vorteil. Deshalb ist es so wichtig, die Augen und vor allem den Blutzucker offen zu halten. Früh erkannt, kann man handeln, statt panisch zu reagieren.
Und wir sehen: Wir brauchen spezialisierte Teams in den Kliniken, die sich nicht nur mit Tumoren, sondern auch mit Hormonen auskennen. Denn die größte Heilkunst ist immer die, die den ganzen Menschen im Blick hat, nicht nur ein Organ, nicht nur eine Krankheit.
Also: Fragen stellen, auf den eigenen Körper hören, Warnzeichen ernst nehmen.