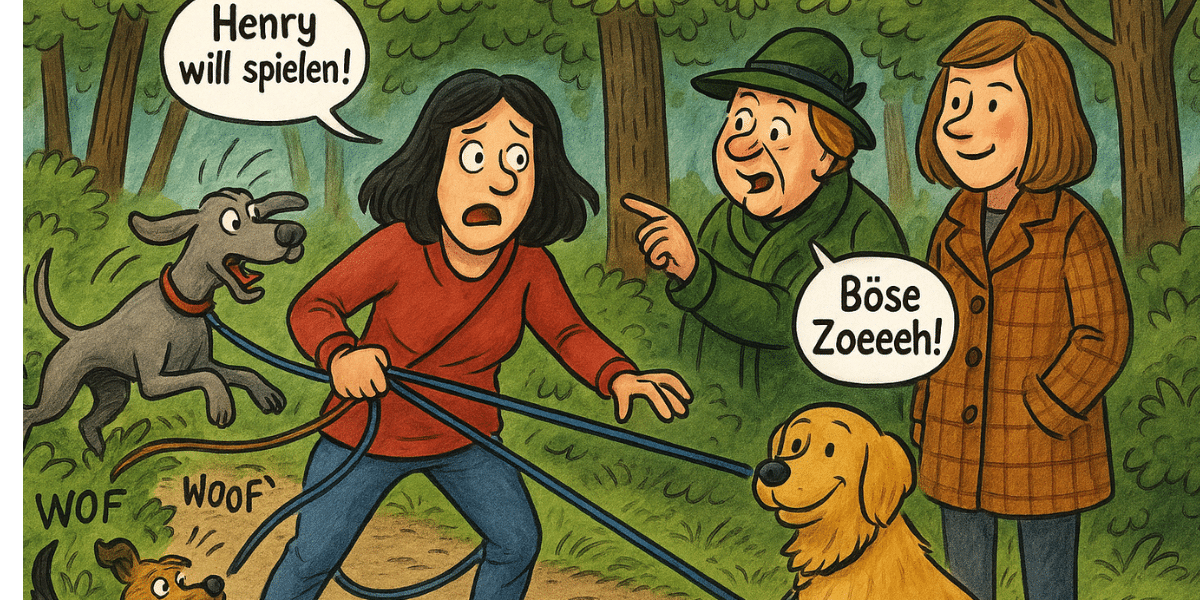Abtauchen ins eigene Ich!
Das eigene Körperinnere sehen und verstehen, das geht in Münster.
An der dortigen Uniklinik ermöglichen Virtual-Reality-Brillen einen völlig neuen Blick ins Körperinnere – dreidimensional, beweglich und fast greifbar. Neurochirurg Prof. Markus Holling setzt die Brillen ein, um komplizierte Eingriffe besser zu erklären und gemeinsam zu planen – Hirntumor-Patienten Alexander Ewen ist als Betroffener beeindruckt: „Für Laien ist die virtuelle 3D-Sicht Gold wert.“
Foto: Prof. Markus Holling, stellv. Direktor der Klinik für Neurochirurgie erläutert, wie die Technik Betroffenen Ängste nimmt und Operationen noch besser planbar macht.
Münster (ukm/lwi). Von außen betrachtet sieht es natürlich seltsam aus, wenn Prof. Markus Holling, mit einem Controller in jeder Hand und einer Virtual Reality (VR)-Brille auf dem Kopf seltsam gestikulierend im Raum steht. Für ihn, der in die Brille blickt, ergibt jede Bewegung aber durchaus Sinn. Er sieht, zoomt, dreht und bewegt, was bislang in dieser Form normalerweise nicht zu sehen ist: Dreidimensionale Bilder aus dem Körperinneren. Ob aus dem Ultraschall, MRT oder CT – sämtliche radiologische Aufnahmen werden in der Regel nur zweidimensional auf Bildschirmen dargestellt. Das Übersetzen in räumliche Maße obliegt der Vorstellungskraft und Erfahrung der Betrachtenden. „In der VR Brille wird ein 3D-Modell von diesen Bildern erstellt, das sich virtuell räumlich darstellen, drehen, vergrößern und schichten lässt“, sagt Holling, der stellvertretender Direktor der Klinik für Neurochirurgie am UKM (Universitätsklinikum Münster) ist.
Für Menschen mit Hirntumoren Gold wert

- Alexander Ewen (l.) ist Glioblastom-Langzeitüberlebender. Er hat sich von Prof. Markus Holling, stellv. Direktor der Klinik für Neurochirurgie, anhand von MRT-Bildern und mit Hilfe der VR-Brille virtuelle Eindrücke seines Gehirns zeigen lassen.
Neben ihm sitzt ein Mann, den das auch interessiert. Alexander Ewen ist kein Mediziner, aber technikbegeistert und langzeitüberlebender Glioblastom-Patient. 2016 wurde der häufigste bösartige Hirntumor bei ihm entdeckt. Seitdem ist der 54-Jährige an der Uniklinik Bonn in Behandlung, hat den Tumor dort entfernen lassen und ist entgegen der Statistik seither frei von einem Rezidiv (also einem Wiederauftreten des Tumors). Er hat im Rahmen einer Krebs-Patienten-Messe von der Technik am UKM erfahren und ein Treffen mit Holling organisiert, um sich sein Gehirn durch die VR-Brille zeigen zu lassen. Nach über 30 MRT-Aufnahmen mit vielen Aufklärungsgesprächen ist der neue Blick auf seine Bilder für ihn etwas Besonderes. „Es ist krass“, sagt Ewen. „Es wird viel deutlicher als in zwei Dimensionen, bei denen man als Laie nicht viel erkennt und bei denen man durch die einzelnen Schichten durchwandern muss. Für Laien ist die virtuelle 3D-Sicht Gold wert“
Was man sieht, kann man verstehen
Do„Die Brillen ermöglichen es uns damit, dem Informationsbedürfnis von Betroffenen viel besser nachzukommen“, spricht Holling aus seiner alltäglichen Erfahrung. „Das ist natürlich nicht für alle etwas, aber den vielen Patientinnen und Patienten, die sich diese Art der Aufklärung wünschen, kann es helfen, Ängste abzubauen. Sie können ihre Erkrankung oder bevorstehende Eingriffe visuell nachvollziehen, dadurch besser verstehen und so ihr Verhalten und damit auch die Genesung positiv beeinflussen.“
Patientinnen und Patienten, bei denen Behandlungen mit Bildern aufwändig erklärt werden müssen, werden am meisten profitieren. Da eignet sich die Neurochirurgie genauso, wie z.B. die Leberchirurgie. Dementsprechend befinden sich die zehn VR-Brillen, die derzeit am UKM im Einsatz sind, sowohl in der Neurochirurgie als auch in der Allgemeinchirurgie und stehen allen anderen Kliniken grundsätzlich zur Verfügung. Dort sind sie aber keineswegs nur für Patientinnen und Patienten gedacht, sondern eröffnen auch dem medizinischen Personal völlig neue Wege in der interdisziplinären Zusammenarbeit – datenschutzkonform und dank WLAN ortsunabhängig. Ärztinnen und Ärzte aus (örtlich) verschiedenen Bereichen, können sich so gemeinsam in eine „Session“ einklinken, Kommentare an die Aufnahme anfügen, Ausmessungen vornehmen oder Operationsschritte visualisieren, kurz: Hochkomplexe Eingriffe lassen sich künftig noch besser planen, erklären und im interdisziplinären Austausch bewerten. Die Bilder und Gespräche eines solchen virtuellen Treffens können die Brillen aufzeichnen. Diese Aufnahmen wiederum lassen sich anschließend nicht einfach nur anschauen, sondern es kann von dort aus auch nahtlos zur weiteren Bearbeitung auf das Originalmodell zugegriffen werden.
„Das die Brillen viele neue Möglichkeiten für schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Aber auch für die Aus- und Weiterbildung jüngerer Kolleginnen und Kollegen sind sie Brillen extrem hilfreich“, sagt Holling und gibt einen Ausblick auf die Zukunft. „Perspektivisch werden die Brillen wahrscheinlich den Bogen von der Aufklärung über die operative Vorbereitung und Therapie bis zu den Kontrolluntersuchungen schlagen und damit allen Beteiligten nützlich sein.“
Der Kommentar von Jonas, unserem Experten für Neurobiologie:
Wer schon einmal beim Arzt versucht hat, auf einem Schwarz-Weiß-Bild des MRTs sein eigenes Gehirn zu erkennen, weiß: Das ist ungefähr so leicht, wie beim IKEA-Regal die Schrauben ohne Anleitung zuzuordnen.
Jetzt stellt euch vor, wir ziehen eine VR-Brille auf und sehen plötzlich unser Gehirn in 3D — in Farbe, drehbar, begehbar! Das ist nicht nur Science-Fiction, sondern passiert tatsächlich am Universitätsklinikum Münster.
Die Idee, Patientinnen und Patienten ihre eigenen Organe so plastisch zu zeigen, finde ich großartig. Denn: Wer versteht, was in ihm vorgeht, hat weniger Angst. Und wer weniger Angst hat, kann auch besser heilen. Das ist keine esoterische Weisheit, sondern gut belegte Medizin.
Außerdem sind VR-Brillen nicht nur für Gamer spannend, sondern auch für Medizinerinnen und Mediziner ein Segen: Komplexe Operationen lassen sich besser planen, komplizierte Sachverhalte endlich mal verständlich erklären und das Ganze wirkt so beeindruckend, dass man fast vergisst, dass man eigentlich im Krankenhaus ist.
Ich bin mir sicher: Hätten wir schon früher solche Technik gehabt, wäre so mancher Chefarzt-Rundgang für manchen Mediziner weniger peinlich verlaufen („Wo ist noch mal das Kleinhirn?“).
In einer Zeit, in der wir alle immer mehr Abstand zu unserem eigenen Körper gewinnen, weil wir lieber die Schritte unserer Smartwatch zählen als auf unser Bauchgefühl hören, bringt uns diese Technik wieder näher an uns selbst.
Also: Hut ab vor dieser Innovation! Oder besser gesagt: Brille auf. Und abtauchen ins eigene Ich.