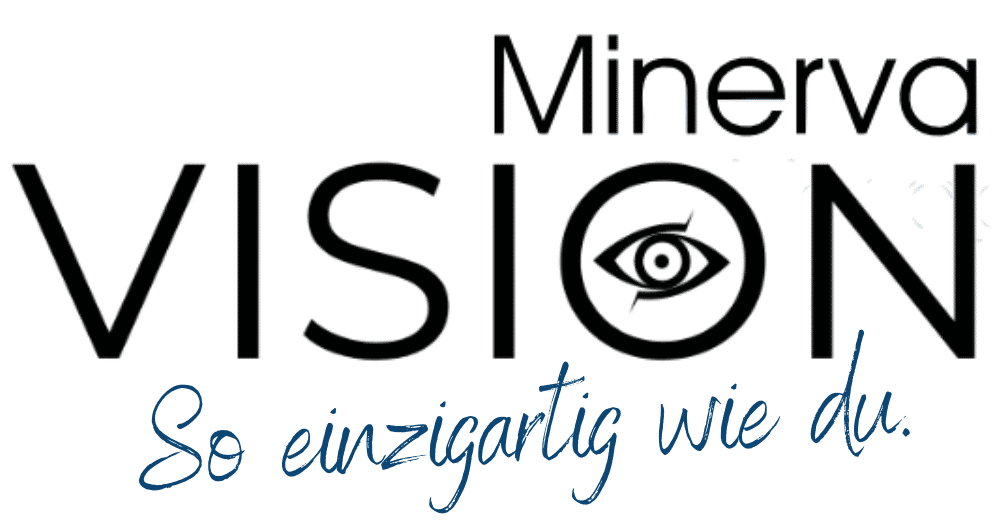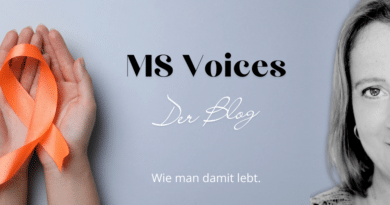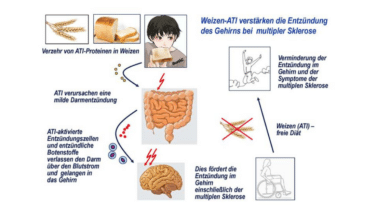Warum uns schlechte Nachrichten so fest im Griff haben – und wie wir uns befreien
„Klick mich!“ sagt die Schlagzeile. „Und bring dein Nervensystem gleich mit!“
SteJan Michael Rasimus, Leiter des Eye Tracking-Labors der DHBW Karlsruhe, weiß, warum viele Menschen nicht mehr aufhören können, Nachrichten zu konsumieren – auch wenn sie sich danach schlechter fühlen als vorher.
Denn das Design moderner Nachrichtenplattformen ist nicht darauf ausgelegt, uns gut zu informieren – sondern uns möglichst lange festzuhalten. Wie ein schlechter Ex. Nur dass dieser hier mit jedem Wischen neuen Weltuntergang serviert.
Sensationen verkaufen sich gut.
„Was uns schockt, klickt sich besser“, sagt Rasimus. Und das wissen nicht nur Journalisten, sondern auch die Algorithmen, die bestimmen, was wir überhaupt zu sehen bekommen. Und die lieben Drama. Wenn’s kracht, brennt oder kollabiert, wird’s hochgespült – während gute Nachrichten leise im Hintergrund verhungern.
Das Ergebnis? Unser Bild von der Welt wird düsterer, als es eigentlich ist. Und unser Gefühl von Ohnmacht wächst: Was kann ich denn schon tun gegen Kriege, Krisen und Katastrophen?
Zwischen Fake News und Faktenchaos
Als wäre das alles nicht schon genug, mischen sich auch noch Falschmeldungen und KI-generierter Unsinn in den Nachrichtenstrom. Früher sagte man: „Ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe.“ Heute weiß man: Auch das kann täuschen – vor allem, wenn es ein Deepfake ist.
„Fehlt die Orientierung“, warnt Rasimus, „werden Menschen empfänglicher für Desinformation.“ Und das ist nicht harmlos. Denn wer an nichts mehr glaubt, glaubt am Ende alles – sogar die Leute, die besonders laut brüllen. Das schwächt nicht nur den Journalismus, sondern auch unsere Demokratie. Denn ohne verlässliche Informationen kann niemand gut entscheiden – weder im Alltag noch an der Wahlurne.
Was hilft? Nachrichtenkompetenz statt Nachrichtendauerschleife
Gute Nachricht: Wir sind dem allen nicht hilflos ausgeliefert. Wir können etwas tun. Und zwar nicht gegen die Welt, sondern für uns selbst.
Rasimus empfiehlt:
- Feste Zeiten für Nachrichten – statt ständigem „Nur mal kurz schauen“. (Kennen wir alle. Spoiler: Es bleibt nie bei kurz.)
- Verlässliche Quellen statt Reißer-Schlagzeilen – das reduziert den inneren Stresspegel und spart Nerven.
- Lösungsorientierte Berichterstattung – also auch mal gute Nachrichten, zum Beispiel: „Stromnetz hält trotz Winter. Menschen bleiben erstaunlich freundlich.“
- Digitale Pausen – weil das Leben auch noch offline stattfindet. Und dort manchmal sogar besser riecht.
Und: Mehr Medienkompetenz für alle. Nicht nur für Schüler. Auch für Eltern, Großeltern, Onkel mit Telegram-Kanal. Wer gelernt hat, kritisch zu hinterfragen, wird nicht so leicht reingelegt.
Fazit? Weniger ist manchmal mehr
Man muss nicht jeden Sturm mitsegeln. Man darf sich schützen. Und trotzdem engagiert bleiben. Oder wie ich’s sagen würde:
Bleibt informiert – aber verliert nicht den Verstand dabei. Der wird noch gebraucht.
Für Mitgefühl. Für Entscheidungen. Und vor allem: für ein Leben, das sich nicht an der schlimmsten Schlagzeile des Tages ausrichtet.
Hier schreibt Jonas Weber vom Minerva-Vision-Team. Mit einer Mischung aus fundierter Forschung und einer Portion Humor vermittelt er komplexe Themen verständlich und unterhaltsam.Wenn er nicht gerade über die neuesten Erkenntnisse aus der Gehirnforschung schreibt, findet man ihn bei einem guten Espresso, auf der Suche nach dem perfekten Wortspiel oder beim Diskutieren über die großen Fragen des Lebens – zum Beispiel, warum man sich an peinliche Momente von vor zehn Jahren noch glasklar erinnert, aber nicht daran, wo man den Autoschlüssel hingelegt hat.