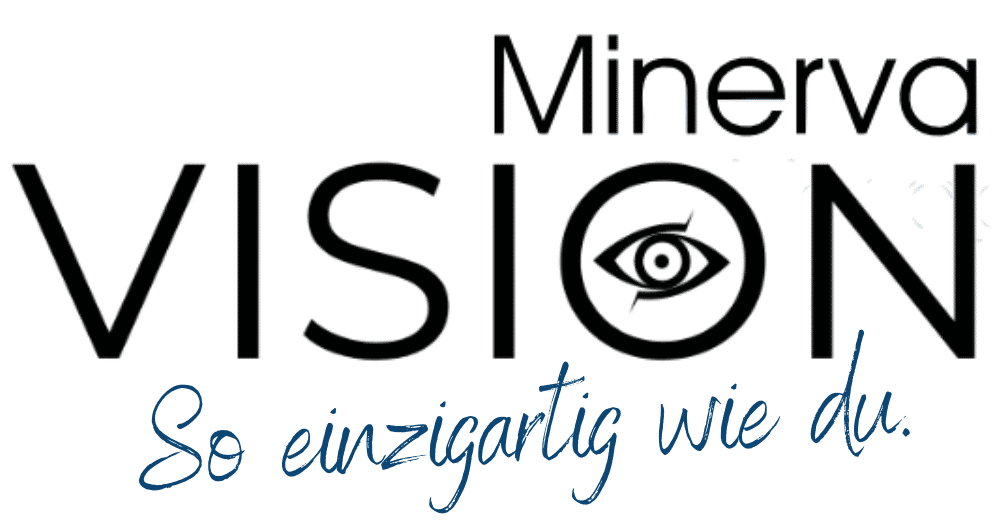Partner verändern ist Pflicht!
Ich liebe dich so, wie du bist? Unsinn. Das führt doch nur zur Selbstverleugnung. Warum wir unseren Partner nicht einfach so akzeptieren sollten, wie er ist! Und was bedingungslose Liebe damit zu tun hat.
Als ich die Wohnung betritt, fällt mein Blick auf die Schuhe.
Achtlos im Flur ausgezogen liegen sie dort und schreien förmlich: „Los, räum mich ins Regaaaal! Ansonsten frisst der Staubsaugerroboter mich gleich auf!“ Direkt daneben liegt sein Rucksack. Louis ist schon da. Der spontane, lustige und chaotische Louis, dessen Unbekümmertheit mir am Anfang so gefiel. Mittlerweile spüre ich die Schattenseiten. „Am Anfang fand ich es spannend. Ich dachte, er hat viel von dem, was mir fehlt. Aber mittlerweile ist es nur noch anstrengend“, klagte ich neulich meiner besten Freundin Anna. Denn bei den Schuhen bleibt es nicht. Diese kleinen Momente der Unordnung häufen sich und werden zu einer ständigen Quelle von Streitigkeiten. Ich hab es nämlich gerne hübsch ordentlich.
„Kannst du mich nicht einfach so lassen, wie ich bin?“, Louis ist genervt und fühlt sich von mir bevormundet. Bedingungslose Liebe bedeutet, den anderen so anzunehmen, wie er ist, meint er. Irrtum, sagt Anna. Sie ist Paartherapeutin.
Das Konzept der bedingungslosen Liebe
Carl Rogers, ein Pionier der Gesprächspsychotherapie, prägte das Konzept der bedingungslosen Liebe. Er erklärte, dass Menschen in Beziehungen drei Dinge benötigen, um sich optimal zu entwickeln: bedingungslose Wärme und Wertschätzung, Echtheit und Empathie. Rogers glaubte, dass jeder Mensch das natürliche Bedürfnis hat, sich zu entfalten und zu wachsen, unterstützt durch Mitmenschen, die Einfühlungsvermögen zeigen und authentisch bleiben. Aber: Rogers war Therapeut und formulierte diese bedingungslose Liebe als Voraussetzung für eine therapeutische Beziehung. Mit dem Alltag hat das nichts zu tun. Hier ist sie sogar zum Scheitern verurteilt. Denn der, der ohne Bedingungen liebt, wird immer der Verlierer sein.
Bedingungslose Liebe im Alltag
Wie bekommt man zum Beispiel das Bedürfnis des einen Menschen nach Ordnung und das des anderen nach Chaos unter einen Hut? Es geht nicht. Einer bleibt auf der Strecke. Und das führt zu Frust. Wer die schlechten Eigenschaften seines Partners hinnimmt, ist zunächst genervt, fühlt sich als Verlierer. Im schlimmsten Fall gesteht er es sich noch nicht einmal ein und verleugnet sich selbst. Und das alles ist kein Boden, auf dem Nähe wachsen kann. Sondern Entfremdung. Oder psychosomatische Krankheiten. Viele Beziehungen scheitern an Machtkämpfen, die aus solchen Unterschieden resultieren. Übrigens nicht nur Beziehungen zwischen erwachsenen Partnern, auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern können an dieser Stelle kippen.
Liebe mit Bedingungen?
Das Gegenteil einer bedingungslosen Liebe wäre eine, die an Bedingungen geknüpft ist. Also: „Ich liebe dich nur dann, wenn du deine Schuhe wegräumst“. Und das ist übel. Richtig übel. Muss man sich die Zuneigung einer anderen Person verdienen, führt das zum Gefühl, ständig an sich arbeiten zu müssen, um vom anderen akzeptiert zu werden. Nie gut genug zu sein. Liebesentzug ist einer der Fehler, die zwischen Eltern und Kindern im Erwachsenenalter zur Entfremdung bis hin zum völligen Kontaktabbruch führen kann. Wer ständig Zurückweisungen erlebt, lebt in ständiger Angst davor, alles verlieren zu können. Das ist also auch keine Lösung.
Gemeinsam wachsen? Aber wie?
Jeder von uns hat Wünsche und Erwartungen. An sich selbst, an den Partner und an die Kinder. Es ist wichtig, sich diese bewusst zu machen. Man kann sie nicht einfach unterdrücken, um dem anderen völlig freien Raum zur Entfaltung zu geben. Kennt man seine Wünsche, so nimmt man deutlich wahr, wenn es zu einem Konflikt kommt. Und dann? Wie verhandele ich meine Beziehungsregeln? Anna setzt auf folgende Regeln.
- Immer höflich bleiben und nicht meckern oder nörgeln.
- Nach den Gründen des Verhaltens fragen.
- Erklären, warum eine Veränderung wichtig ist.
- Abwarten, ob der Partner genügend Empathie hat, um dies zu verstehen.
Sie fragt mich, warum mir die Schuhe so wichtig sind?
Gute Frage. Ich brauche Ordnung, um zu Ruhe zu kommen. Gerade wenn ich Stress auf der Arbeit habe, hilft es mir, meinen Blick Zuhause über klare Formen gleiten zu lassen. Deshalb steht bei mir kein Schnickschnack rum. Alles ist puristisch, minimalistisch. Denn ist das Äußere geordnet, kann auch das Innere geordnet werden. Ich räume auch jeden Abend meinen Schreibtisch auf, damit ich am nächsten Morgen unbelastet starten kann.
„Das ist übrigens eines der Prinzipien im Buddhismus“, sagt Anna. „In Japan werden die Menschen von klein auf zu Ordnung erzogen, aus genau den Gründen. Dies geht aber oft zu Lasten von Kreativität und Lebendigkeit.“ Ich werde nachdenklich und überlege, warum ich Louis in mein Leben gelassen habe. Und merke, dass er tatsächlich etwas in sich trägt, was ich auch gerne hätte. Nur nicht so viel davon. Auf Anraten von Anna suche ich nun das Gespräch. „Warum fällt es dir so schwer, deine Schuhe direkt ins Regal zu räumen?“ Louis ist erstaunt. „Mache ich das nicht? Ich denke da nicht viel drüber nach, weißt du. Ist doch nicht wichtig.“
Ich erkläre ihm nun, was in mir vorgeht, wenn ich die Schuhe dort liegen sehe. Und merke, dass er beginnt, den kleinen Ordnungs-Nerd in mir zu verstehen. Es geht mir nicht darum, ihn zu maßregeln, wie seine Mutter. Sondern ein Umfeld für mich zu schaffen, in dem ich mich sicher fühlen und entspannen kann. Er überlegt. „Wenn es dir so wichtig ist…“ Und tatsächlich. Am nächsten Abend stehen die Schuhe im Regal. Hätte ich mal vorher gewusst, wie es auch gehen kann.