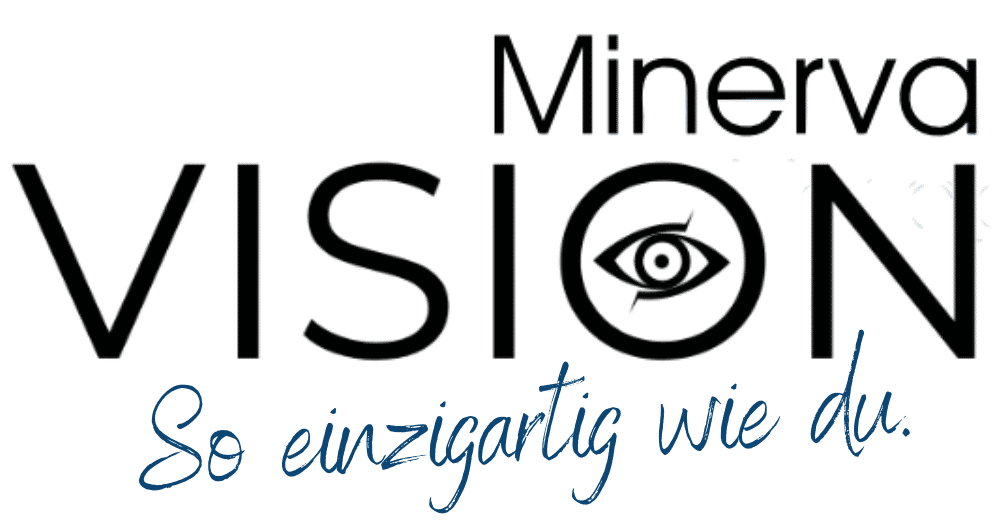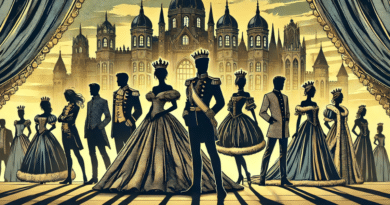Bodenqualität beurteilen und verbessern
Die Bodenqualität im Garten zu beurteilen und zu verbessern, ist keine Frage der Ästhetik – es geht um das Fundament allen Lebens. Der Boden ist ein pulsierendes Ökosystem, ein Zuhause für Milliarden von Mikroorganismen, die unsere Pflanzen mit Nährstoffen versorgen und den Boden lebendig halten.
Stellen wir uns den Boden als eine riesige Speisekammer vor. Wenn er gesund ist, sind die Regale voll – mit Nährstoffen, Wasser und Luft für die Pflanzenwurzeln. Ist der Boden aber verdichtet, ausgelaugt oder chemisch belastet, stehen unsere Pflanzen buchstäblich vor leeren Regalen. Sie hungern, wachsen schwach und sind anfälliger für Krankheiten. Unsere Autorin, Schwester Christa, ist eine echte Fachfrau für den Bio-Garten. Die Gartenbauingenieurin und Ordensfrau der Benediktinerinnen Abtei zur Heiligen Maria betreut seit vielen Jahren den Garten der Abtei Fulda, der weit über die Stadtgrenzen hinaus für seine biologische Anbauweise bekannt ist.
Jahrtausende, ja, in manchen Fällen sogar Jahrmillionen hat es gedauert, bis sich der Boden, auf dem wir heute stehen, gebildet hat. Ein kurzer Regenschauer reicht jedoch aus, um ihn in Massen fortzuschwemmen, und ein wenig Chemie genügt, um ihn für lange Zeit unbrauchbar zu machen. Dabei wissen wir längst: Der Boden ist weit mehr als nur ein Ort, an dem Pflanzen wachsen. Er ist ein komplexes System, ein lebendiger Organismus, der nicht nur unsere Nahrung liefert, sondern auch eine unverzichtbare Rolle als Filter und Puffer für unsere Umwelt spielt.
Doch wie erkennt man einen gesunden Boden?
Ein kranker, geschädigter Boden lässt sich leicht beschreiben: verdichtet, verkrustet, ausgelaugt – und davon gibt es mehr als genug. Aber ein wirklich gesunder Boden? Schon seine Entstehung variiert gewaltig, abhängig von unzähligen Faktoren. In den wenigen Zentimetern, die wir als „Boden“ bezeichnen, überschneiden sich sämtliche Sphären unseres Planeten: die Lithosphäre, das feste Gestein, das als Fundament dient; die Hydrosphäre, das allgegenwärtige Wasser; die Atmosphäre, die Luft, die in den Bodenporen zirkuliert; und die Biosphäre, der pulsierende Lebensraum voller Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere. Unser Boden ist also ein Wunderwerk der Natur – wertvoll, empfindlich und unersetzlich.
Ein lebendiger Boden setzt sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen: mineralische Bestandteile, also verwittertes Gestein; organische Substanz, bestehend aus abgestorbenen Pflanzenresten, Bodenorganismen und Humus; sowie Wasser und Luft. Doch er ist nicht statisch. Ständig befinden sich seine Elemente in Bewegung, durchdringen und verändern sich gegenseitig. Ein Boden lebt – und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein altes Bauernsprichwort besagt: „Bodengare ist das Geheimnis der Fruchtbarkeit.“
Doch was genau bedeutet „Gare“? Ein gesunder Boden ist locker, durchlüftet und gut strukturiert – ein perfektes Zuhause für Wurzeln und Bodenlebewesen. Ein kranker Boden hingegen ist verhärtet, verdichtet oder verschlämmt. Gare beschreibt also den Zustand der Bodenstruktur. Doch Vorsicht: Ein Boden, der nur durch Umgraben oder Frost aufgelockert wurde, ist noch lange nicht wirklich „gar“. Erst wenn die Krume über eine gesamte Vegetationsperiode hinweg krümelig bleibt und nicht unter dem Einfluss von Regen in sich zusammenfällt, kann man von echter Gare sprechen.
Besonders die sogenannte Frostgare ist trügerisch.
Sie entsteht, wenn der Boden im Herbst umgegraben und anschließend durchfriert. Im ersten Moment scheint der Boden wunderbar locker zu sein, doch nach kurzer Zeit verklumpt und verkrustet er wieder. Wahre Gare hingegen entsteht nicht durch Umgraben, sondern durch Leben. Humus ist hier der Schlüssel – eine Mischung aus abgestorbenem, aber umgewandeltem organischen Material, die dem Boden Struktur gibt. Außerdem braucht ein gesunder Boden Platz für Luft und Wasser sowie ein Heer von Mikroorganismen, die ihn ständig umgestalten und fruchtbar halten. Tatsächlich steckt in einer einzigen Handvoll guter Gartenerde mehr Leben, als Menschen auf unserem Planeten existieren. Diese unermüdlichen Arbeiter sorgen dafür, dass unser Boden lebendig bleibt – und damit auch unsere Zukunft sichert.
Wie Humus im Boden wirkt
Der wichtigste Garant einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit ist der Humus. Als Nährhumus dient er als Nahrungsgrundlage für das Bodenleben. Nur wenn genügend organisches Material im Boden ist, können Klein- und Kleinstlebewesen im Boden existieren und sich vermehren. Durch die Arbeit der Bodenorganismen werden Nährstoffe freigesetzt, mineralisiert und für die Pflanzen verfügbar gemacht. Daraus ergibt sich die Düngewirkung des Humus. Dazu kommt, dass Humus auch Vitamine, Wuchsstoffe und Spurenelemente enthält und eine Reihe Wirkstoffe, die von großem Einfluss auf die Widerstandskraft von Pflanzen sind. Die Atmung der Bodenorganismen setzt eine Menge Kohlendioxid frei, was ebenfalls von den Pflanzen zum Aufbau von Traubenzucker in den Blättern benötigt wird.
Als Dauerhumus dient er als Bodenverbesserer. Humus trägt wesentlich zur Verbesserung der Bodenstruktur bei, sowohl bei leichten als auch bei schweren Böden. Schwere Böden werden aufgelockert und dadurch besser durchlüftet. Verschlämmen und Verdichten des Bodens wird verhindert. Sandige, leichte Böden dagegen brauchen den Humus, um Wasser und Nährstoffe besser festzuhalten und bei Bedarf an die Pflanzenwurzeln abgeben zu können. Durch Lebendverbauung und Bildung von Ton-Humuskomplexen werden Krümelstabilität und dadurch die Bodengare erhöht. Die vielfältigen Bodenorganismen und größeren Bodentiere bewirken durch ihre Tätigkeit und Bewegung eine optimale Porenverteilung. Sowohl große Poren für ausreichende Belüftung als auch feine Poren, um Wasser zu speichern, werden geschaffen. Durch die grabende Tätigkeit des Regenwurms werden zudem Hohlräume geschaffen, in die die Pflanzenwurzeln leicht eindringen können und deren Wände dazu noch mit den besonders nährstoffreichen Exkrementen des Regenwurms ausgekleidet sind. Dass die Bodenstruktur auf das Pflanzenwachstum großen Einfluss hat, zeigt folgendes Beispiel: Durch Erdflohfraß traten vor allem auf trockenem, verhärtetem Boden schwere Schäden an Kohlsetzlingen auf und die jungen Pflanzen kümmerten vor sich hin. Die gleichen Pflanzen auf lockerem, garen Boden wurden ebenfalls von Erdflöhen befallen. Sie wuchsen aber den Schädlingen praktisch davon, während auf verhärtetem Boden schon einige Löcher in den Keimblättern erhebliche Wachstumsstörungen auslösen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Erhöhung der Speicherkapazität der Böden durch Humus- und Pufferwirkung.
Humus als Garant der Bodengesundheit
Besonders wichtig ist jedoch der Humus als Garant der Bodengesundheit. Pflanzenpathologen, die sich mit dem Boden befassen, suchen heute wieder verstärkt nach Möglichkeiten, eine gewisse Eigenabwehr des Bodens und der Pflanze zu erfassen und aufzubauen. Dieses Abwehrpotenzial des Bodens gegenüber krankmachenden Keimen ist im reinen Mineralboden gleich null, in Humusböden entsprechend höher. Dabei wurden folgende Wirkungen des Humus herausgefunden:
- Erhöhte Humusgaben führen zu gesteigerten Krankheitsresistenzen der Pflanzen, die nicht nur mit der verbesserten Nährstofflage erklärt werden können.
- Organische Substanz im Boden kann bestimmte Parasiten verdrängen, von Pflanzeninfektionen abhalten und eventuell über die Mikrofauna beseitigen.
- Bei reichlichem Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch Gründüngungen, können Pilze und Bakterien in verstärktem Maße antibiotische Stoffe zur Abwehr von Pflanzenerkrankungen bilden.
- Gegen Mehltau, Kraut- und Knollenfäule und andere Pilzerkrankungen werden sogar Spritzmittel aus Kompostauszügen hergestellt.
- Im Wurzelbereich der Pflanzen besteht eine Mikrobenflora, die krankmachende Keime abwehren kann.
Humus dient der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
Dass die Erträge auf Böden mit hohem Humusgehalt höher und sicherer sind, ist erwiesen und steht auch bei konventionell arbeitenden Landwirten und Gärtnern außer Frage. Schon geringe Humusgehalte von mindestens 2 % verhindern bei falscher Bodenbearbeitung das Totfräsen der Böden. Die Erhaltung und Erhöhung des Humusgehalts im Boden muss daher das Ziel des Gärtners sein. Als Richtmaß für den jährlichen Humusbedarf gelten 40 dt Trockenmasse organischer Substanz pro ha. Umgerechnet auf einen Quadratmeter Gartenboden wäre das 0,4 kg getrockneter organischer Dünger. Bei normalem Gartenkompost rechnet man 2-5 kg pro Quadratmeter. Dabei ist zu beachten, dass eine einmalige große Menge Kompost zur Bodenverbesserung förderlicher ist, weil so mehr stabile Humusverbindungen aufgebaut werden. Die gleiche Menge, auf mehrere Gaben im Laufe des Jahres verteilt, wird schneller abgebaut und ist als Dünger geeigneter. Humuszufuhr ist möglich durch Kompost, kompostierten oder abgelagerten Mist. Frischer Mist sollte nicht in den Gartenboden eingearbeitet werden. Ebenfalls geeignet sind Ernterückstände, Gründüngungen und Bodenbedeckung.
Der Boden ist ein uns anvertrautes Gut. Diese hauchdünne Schicht an der Oberfläche unseres Planeten ist doch die Lebensgrundlage für Pflanze, Tier und Mensch. Und das begreifen heute leider noch viel zu wenige Menschen. Er ist ein Gut, das geschützt werden muss, das nicht unbegrenzt belastet und ausgebeutet werden kann.