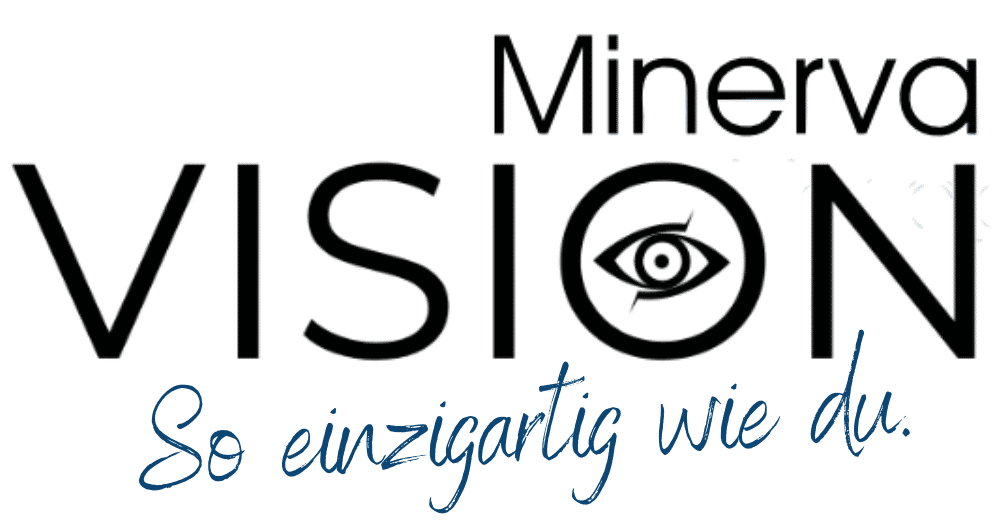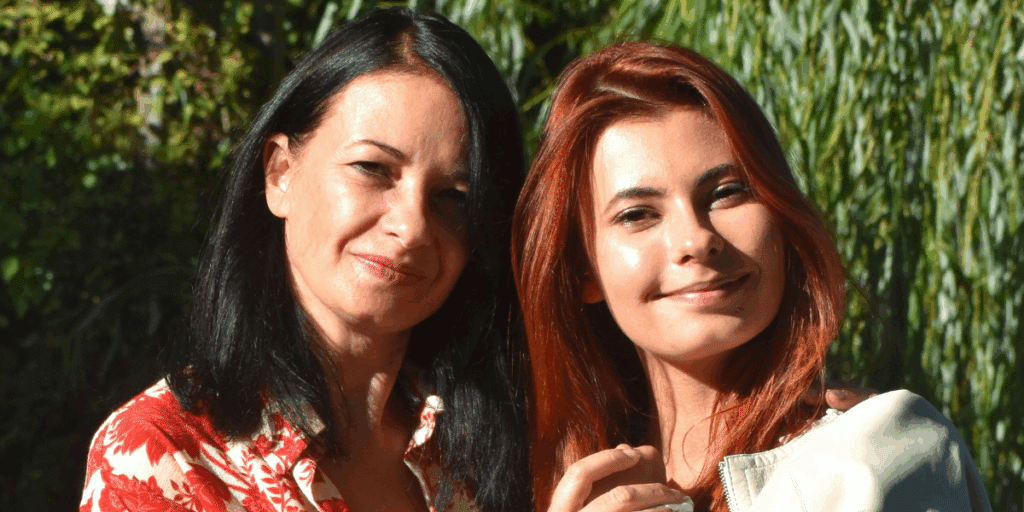
Warum ich meiner Mutter endlich Grenzen setzen musste
Von Kim Hansson
Gestern wieder: Das Telefon klingelt um halb acht am Morgen. Meine Mutter. “Ich habe gesehen, dass bei euch schlechtes Wetter ist. Zieh den Kindern warme Jacken an!” Ich bin 42 Jahre alt, habe zwei Teenager und einen Job, der mich fordert. Aber meine Mutter ruft immer noch täglich an, kommentiert meine Entscheidungen und gibt mir ungefragt ihre Ratschläge. Lange dachte ich, das sei normal, ihre Art von Fürsorge. Bis mir klar wurde: Das ist emotionale Kontrolle. Und Mütter haben eine Macht über uns, die wir oft unterschätzen.
Wenn Mutter nicht loslassen kann
Kennst du das auch? Diese täglichen Anrufe, die sich anfühlen wie ein sanfter Würgegriff? Bindungen zwischen Eltern und Kindern sind natürlich und wichtig. Doch wenn aus gesunder Verbundenheit emotionale Abhängigkeit wird, leiden alle Beteiligten. Ich erkannte die ungesunde Mutter-Tochter-Bindung erst spät: Ich dachte nämlich ständig daran, was meine Mutter wohl zu meinen Entscheidungen sagen würde. Ich fühlte mich emotional abhängig von ihrer Zustimmung und ihren Stimmungen.
Noch schlimmer: Ich merkte, dass ich unbewusst ihre Meinungen übernahm, ohne sie zu hinterfragen. Wenn sie sagte, mein Partner sei “nicht der Richtige”, zweifelte ich sofort an meiner Beziehung. Gleichzeitig fühlte ich mich nach ihren Anrufen oft ausgelaugt und energielos – ein klares Warnsignal dafür, dass unsere Mutter-Tochter-Beziehung aus dem Gleichgewicht geraten war.
Die unsichtbare Macht
Mütter haben eine besondere Macht über ihre Kinder – selbst wenn wir längst erwachsen sind. Diese Macht entsteht durch jahrelange emotionale Prägung und die tiefe Sehnsucht nach mütterlicher Anerkennung, die viele von uns ein Leben lang in sich tragen. Meine Mutter musste nur einen bestimmten Tonfall anschlagen, und schon fühlte ich mich wieder wie ein kleines Mädchen, das Angst hat, etwas falsch zu machen.
Besonders ausgeprägt ist diese Dynamik in vielen asiatischen Kulturen. Die Emotionen, über die chinesische Erziehung das Kind formt, sind vor allem die Gefühle der sozialen Verpflichtung und der Scham. Asiatische Mütter gelten als wahre Meisterinnen darin, ihre Kinder durch Schuldgefühle zu lenken. Kinder zu loben, ist traditionell wenig üblich, weil es als unbescheiden gilt, stattdessen wird mit Kritik und dem Verweis auf Familienpflichten gearbeitet. Meine Freundin Li erzählte mir einmal: “Wenn ich meiner Mutter sagte, ich sei glücklich, antwortete sie: ‘Glück ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du uns Ehre machst.'” Diese kulturell geprägte Erziehung durch Scham und Verpflichtung kann selbst im Erwachsenenalter noch tiefe Wurzeln haben.
Eine gesunde Mutter-Tochter-Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass beide Seiten emotional frei sind. Ich liebe meine Mutter bedingungslos, aber ich wollte nicht mehr von ihr kontrolliert oder besessen werden. Problematisch wurde es, als mir klar wurde, dass sie das Gefühl hatte, ich müsse nach ihren Vorstellungen leben. Jedes Mal, wenn ich eigene Wege ging, reagierte sie verletzt oder vorwurfsvoll.
Mein Weg zum Loslassen
Der Wendepunkt kam, als ich bemerkte, dass ich meine eigene Identität zu verlieren drohte. Ich sprach wie meine Mutter, übernahm ihre Ansichten unreflektiert und fragte mich bei jeder Entscheidung: “Was würde Mama dazu sagen?” Das war der Moment, in dem ich verstand, dass hier irgend etwas gehört schiefläuft.
Ich dachte an Tiere, die ihre Jungen ziehen lassen, wenn diese erwachsen sind. Genau das hatte meine Mutter versäumt und ich musste es für uns beide nachholen. Loslassen bedeutete nicht, dass ich aufhöre, sie zu lieben. Ganz im Gegenteil. Es bedeutete, ihr und mir die Freiheit zu geben, eine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe zu führen.
Konkrete Schritte, die ich gegangen bin
Der erste Schritt war die ehrliche Selbstreflexion: Ich erkannte an, dass unsere Bindung zu eng geworden war. Ich vergab mir selbst und meiner Mutter für die Verletzungen, die durch diese zu enge Verbindung entstanden waren. Dieser Vergibungsprozess war wichtig, um alte emotionale Lasten loszulassen.
Dann schuf ich bewusst Distanz, wo nötig. Ich stellte mein Telefon morgens auf stumm und rief nur noch jeden zweiten Tag zurück. Ich hörte auf, bei jeder Entscheidung nach ihrer Meinung zu fragen. Stattdessen konzentrierte ich mich auf mein eigenes Leben und meine eigenen Interessen – eine Erfahrung, die sich zunächst seltsam und schuldig anfühlte.
Was sich verändert hat
Ich war darauf vorbereitet, dass sich unsere Beziehung verändern würde. Zunächst kühlte sie tatsächlich ab. Meine Mutter war verletzt. „Nie hast du Zeit!“, hieß es dann. Das kostet Kraft, glaubt mir. Aber ich musste lernen, mich nicht mehr über die Erfolge oder Sorgen meiner Mutter zu definieren. Je mehr ich mich auf mein eigenes Leben konzentrierte, desto mehr neue Interessen entwickelte ich. Ich ging in einen Buchklub, pflegte Freundschaften intensiver und machte eine Fortbildung zur Pilates-Trainerin. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich wieder wie ich selbst, frei und gut.
Das größte Geschenk
Heute weiß ich: ich musste loslassen, um mich selbst zu finden. Meine Mutter und ich haben heute eine bessere Beziehung als je zuvor. Wir telefonieren wieder täglich, aber wenn sie mir Ratschläge gibt, höre ich zu und entscheide dann selbst. Die Phase der Trennung war das größte Geschenk, das ich uns beiden gemacht habe.
Kommentar von Nina, unserem Mental-Health-Coach:
Viele Menschen glauben, dass Liebe und Nähe bedeuten, sich selbst aufzugeben. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Eine gesunde Beziehung, auch die zu den eigenen Eltern, braucht die Fähigkeit, „Nein“ zu sagen. Wenn ein erwachsenes Kind beginnt, der Mutter Grenzen zu setzen, geht es nicht darum, sie zu verletzen oder undankbar zu sein. Es geht darum, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wahre Nähe entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Authentizität.
In meinem Verständnis ist die wichtigste Aufgabe für uns Erwachsene, die Beziehung zu unseren Eltern von einer hierarchischen Abhängigkeit zu einer Begegnung auf Augenhöhe zu entwickeln. Das bedeutet, sich zu erlauben, ein eigenes Leben zu führen, eigene Werte zu leben und die eigene Identität zu schützen, auch wenn das für die Eltern zunächst schmerzhaft sein kann.
Viele Mütter fühlen sich gekränkt, wenn ihre Kinder beginnen, eigene Wege zu gehen. Sie erleben das als Ablehnung oder Liebesentzug. Doch genau hier liegt ein entscheidender Punkt: Wir können nicht für die Gefühle unserer Eltern verantwortlich sein. Wir können sie lieben, ohne ihre Erwartungen ständig erfüllen zu müssen. Der Weg über Schuldgefühle und innere Zweifel ist oft steinig, aber er führt zu einer reiferen Beziehung — nicht nur zur Mutter, sondern vor allem zu sich selbst.
Am Ende wird klar: Grenzen zu setzen ist kein Akt der Härte, sondern ein Akt der Liebe. Denn nur wer sich selbst treu bleibt, kann auch anderen ein verlässlicher, liebevoller Mensch sein.